http://web.archive.org/web/20100801083949/http://cash.ch/blogs/wolf/2005/08/
CashBlog (nicht mehr online)
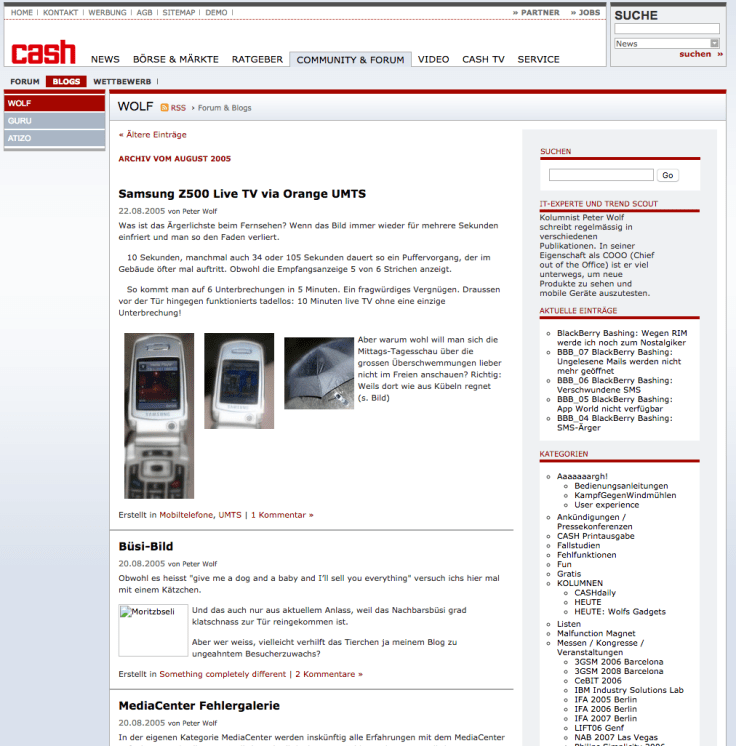
http://web.archive.org/web/20100801083949/http://cash.ch/blogs/wolf/2005/08/
CashBlog (nicht mehr online)
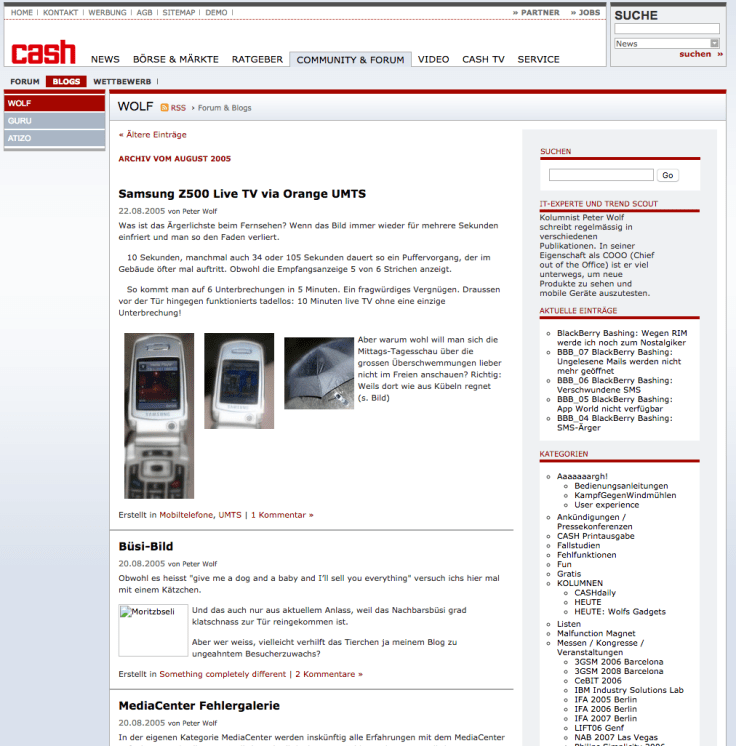
DIGITALBILDER Programme zum Bearbeiten, Ablegen, Präsentieren und Wiederfinden von Bildern.
VON PETER WOLF UND PASCAL ZEMP
Früher quollen die Schuhkartons über mit Fotos und Negativen – heute sinds die Festplatten. Am grundlegenden Problem mit Ablage und Ordnung hat sich also auch im Zeitalter der Digitalfotografie nicht viel geändert. Ausser dass mittlerweilen Software existiert, die dabei helfen kann.
Dass mit Digicams heute ein Mehrfaches an Bildern geschossen wird als früher auf Film, bedeutet nicht, dass die Ausbeute auch um dieses Vielfache besser ist. Im Gegenteil: Weils ja kein Material kostet, wird einfach mal wild drauflosgeschossen. Löschen kann man die schlechten Fotos später ja immer noch.
Diese Grundhaltung trägt ebenfalls zum Anwachsen des Datenbergs bei. Daher muss zuerst mal alles Unbrauchbare entfernt werden. Sowohl bei iPhoto als auch bei Picasa blättert man dazu mit den Pfeiltasten durch die vorhandenen Fotos und befördert die unscharfen oder missglückten mit der Löschtaste in den Papierkorb.
Nach dem Aussortieren unbrauchbarer Bilder gehts dann ans Bearbeiten derjenigen, die der Nachwelt erhalten bleiben sollen: Drehen: Liegende Bilder sollten aufrecht gestellt werden. Auch das geht in der Regel mit Tastenkombinationen. Es lohnt sich, diese auswendig zu lernen.
Schneiden: Selbst langweilige Bilder gewinnen durch Konzentration aufs Wesentliche.
Schärfen: Vorsicht – nicht übertreiben, sonst siehts unnatürlich aus. Und wirklich unscharfe Bilder lassen sich damit nicht mehr retten.
Rote Augen korrigieren: Die meisten Programme bieten dafür einen speziellen Menüpunkt an. Aber besser wärs natürlich, man hätte bereits beim Fotografieren den Vorblitz verwendet, der dafür sorgt, dass sich die Pupillen schliessen.
Grösse bearbeiten: Reduzieren Sie die Dateigrösse, bevor Sie Bilder per E-Mail verschicken, indem Sie die Abmessungen des Fotos verringern oder bei JPG-Bildern eine stärkere Kompressionsstufe wählen. Diese Operation hat dann allerdings einen Einfluss auf die Bildqualität.
Nebst den hier vorgestellten iPhoto und Picasa sind auch die Gratisprogramme GraphicConverter (für Macintosh, http://www.lemkesoft.com) und IrfanView (für Windows, http://www.irfanview.de) sehr empfehlenswert. Einen abgespeckten Photoshop von Adobe (Photoshop Elements 3.0) gibts für 130 Franken (Macintosh und Win).
iPhoto für Mac
iPhoto macht mit Bildern das, was iTunes mit Musik macht. Die Software ist leicht zu bedienen, enttäuscht aber Benutzer nicht, die professionelle Ansprüche an Retouchen und Ausgabemöglichkeiten stellen. Wenn man die Bilder in der Übersicht verkleinert, kann man flugs über sein bebildertes Leben fliegen, Fotos für Diaschauen zusammenstellen, direkt Papierabzüge oder bei Apple qualitativ hochwertige Fotobücher bestellen. Backup-CD für Archiv und DiaschauDVD für den Fernseher vom Grosi sind nur einen Klick weit weg. iPhoto liegt jedem Mac gratis bei, kann aber auch für 109 Fr. bestellt werden. Man kann Apple nur eines vorwerfen: dass iPhoto nicht analog zu iTunes auch für Windows-Benutzer verfügbar ist. http://www.apple.com/chde/iphoto
Picasa für Windows
Das Gratisprogramm stöbert nicht nur sämtliche Bilder auf der Festplatte auf, wenn ein voller Fotoapparat mit dem PC verbunden wird, importiert es alle neuen Bilder. Und nur diese, sodass doppelt abgelegte Dateien der Vergangenheit angehören. Gleich beim Importieren, aber auch später noch können liegende oder Kopf stehende Bilder gedreht werden, zudem lassen sie sich zuschneiden, von roten Augen befreien und mit Effekten verzieren. Backups oder Geschenk-CD mit ausgewählten Bildern sind einfach gebrannt. Sehr schön ist die Zeitachse, entlang derer man sich bewegt und mit der man die Fotos chronologisch geordnet wiederfindet. Ausserdem kann man jedem Bild diverse Etiketten verleihen, nach denen sich auch suchen lässt. http://www.picasa.com
CALLCENTER Pro Tag rufen bis zu 25000 Kunden bei der Swisscom an. 25000 Möglichkeiten, sie an sich zu binden – oder zu verärgern. Darum richten die Chefs ein besonderes Augenmerk darauf.
VON PETER WOLF
Carsten Schloter, Chef von Swisscom Mobile, setzt sich nicht nur für den Fotografen zu seinen Mitarbeitern an die Hotline. Der Manager begibt sich immer wieder selber an die Front, um zu erfahren, wo der Schuh drückt und welche unerfüllten Bedürfnisse im Markt herumgeistern. Dieses Jahr half er bereits zweimal in einem Swisscom-Shop mit («dort haben wir immer noch Probleme, obwohl wir die Wartezeiten von zehn auf drei Minuten senken konnten») und dreimal in einem Callcenter.
Was er tut, ist für das ganze Swisscom-Kader mittlerweile Pflicht geworden: Das Programm Shop Experience wurde Ende 2003 gestartet und ist obligatorisch für alle Kadermitglieder. Sie verbringen mindestens zwei Tage pro Jahr an einem Kundenkontaktpunkt, sei dies nun ein Shop oder eine Hotline. Und sie haben auch alles Interesse daran: Ihre Bonusberechtigung ist nicht nur an Umsatz und Betriebsergebnis gekoppelt, sondern ebenso stark an die Kundenzufriedenheit. Und diese wird monatlich erhoben.
Ein Agent nimmt Jahr für Jahr rund 16000 Anrufe entgegen
Als sich Schloter letzte Woche in Olten zu Call-Agent Christian Ryser setzte und mithörte, hatte er Ahaund Erfolgserlebnisse: «Ich habe gesehen, dass sich unsere Investitionen ins CRM-System gelohnt haben, aber die Systemunterstützung im Backoffice könnte besser sein. Dort müssen die Leute immer noch zwischen vier, fünf Systemen hin- und herwechseln.» Jeder der schweizweit über 600 Call-Agents beantwortet im Jahr rund 16000 Telefonate. Wer die Nummer 0800 55 64 64 wählt, landet in Olten, Chur, Bellinzona oder Lausanne. An Werktagen treffen dort bis zu 25000 Anrufe ein. Dazu kommen noch Faxe, Briefe und E-Mails, die innert anderthalb Tagen verarbeitet werden müssen. All dies ist aber nicht gleichmässig über den Tag verteilt. Es treten immer wieder unplanbare Spitzen auf, wenn zum Beispiel ein Netz ausfällt oder eine Spam-Welle schwappt.
Mittlerweile weiss man wenigstens, wann die Leitungen regelmässig heiss laufen: Während und nach dem Rechnungsversand, wenn Fragen zu den Kosten auftauchen. Und in diesem Zusammenhang hatte Schloter letzte Woche denn auch sein Erfolgserlebnis: «Ein NatelBudget-Kunde rief an und wollte einen Verbindungsnachweis. Wir haben gesehen, dass er seine monatliche Telefonrechnung von rund 160 Franken mit dem Liberty-Angebot auf etwa 30 Franken senken könnte. Und das haben wir ihm dann auch gesagt.»
Ist das nicht gut für die Kundenzufriedenheit, aber schlecht für den Umsatz? Schloter, der monatlich selber zwischen 200 und 300 Franken vertelefoniert: «Im Gegenteil. Irgendwann hätte der Kunde das auch selber herausgefunden, wäre dann verärgert gewesen und hätte vielleicht sogar den Anbieter gewechselt.» Daher sei transparente Information wichtig. Die Hotline ist für jedes Unternehmen eine der besten Möglichkeiten, mit seinen Kunden in Kontakt zu treten, und entsprechend wichtig ist sie der Swisscom auch, gibt sie doch jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag dafür aus. Zusätzlich werden die Call-Agents laufend geschult.
MOBILTELEFONE Wenn ein neues Handy her soll, dann heisst es zunächst meist: «Ich will ja nur telefonieren können damit.» Weil aber jeder erfüllte Wunsch augenblicklich Junge kriegt, zeigen wir hier, was heutige Handys sonst noch so können.
SKYPEN UND VOIPEN Per Internet kann günstiger und komfortabler telefoniert werden.
VON PETER WOLF
Niemand wird in zehn Jahren mehr fürs Telefonieren zahlen», verkündete Niklas Zennström, Chef des Internettelefon-Dienstes Skype, letzte Woche im CASH-Interview. Tatsächlich kann man heute bereits mit einem Computer und entsprechender Software gratis telefonieren, solange das Gespräch am anderen Ende ebenfalls auf einem PC landet.
Aber auch Auslandsgespräche auf ein Fixnetztelefon werden massiv günstiger, wenn sie den langen Weg ins ferne Ausland durch den Cyberspace zurücklegen und erst im Ankunftsland ins lokale Festnetz eingespeist werden. Der Anrufer muss dann nur diese Kosten übernehmen, was bei Skype je nach Land um bis zu 70 Prozent günstiger ist als übers konventionelle Telefonnetz.
Selbst für lokale Gespräche lohnt es sich, den Computer zum Telefonieren zu nutzen. Dann zwar nicht wegen der Preisersparnis, sondern wegen des Komfortgewinns. Das integrierte Telefonbuch verbindet einen nicht nur auf Mausklick mit dem Gesprächspartner, es zeigt auch an, ob er überhaupt vor seinem PC sitzt und online ist. Denn für die Internettelefonie brauchts einen Breitband-Internetzugang sowie Software und am besten einen Kopfhörer mit Mikrofon.
Skype ist zwar nicht die einzige, aber die führende Anwendung für die Internettelefonie. Das Programm wurde bereits 132 Millionen Mal von http://www.skype.com heruntergeladen. Die Chancen sind also gross, dass einige Bekannte das Programm ebenfalls einsetzen. Nicht nur Private, auch Firmen können mit der Internettelefonie massiv Geld sparen. Für wenige hundert Franken gibts eine Telefonzentrale, an die sich die normalen Telefonapparate anschliessen lassen. Bei jedem Anruf schaut die Anlage selbsttätig, ob sie das Gespräch per Internet weiterleiten kann, ohne dass die Anrufer dazu beitragen müssen. Diese Anschaffung kann sich sogar nicht nur für Firmen mit Auslandsniederlassungen lohnen, sondern auch für Familien mit plapperndem Nachwuchs (den Epigy Quadro 2X für Kleinstunternehmen bis zu vier Mitarbeitern gibts für 500 Franken, eine Version für bis zu 15 Mitarbeiter kostet 2200 Franken).
Seit kurzem ist auch das Problem gelöst, wie sich Festnetznummern mit ins Internet nehmen lassen. Unter http://www.swissenum.ch oder bei http://www.enumschweiz.ch kann man seine eigene Telefonnummer in eine Internetadresse übersetzen lassen. Unter dieser ist man dann überall erreichbar, wo man online ist.
Vorläufig braucht es für die Internettelefonie noch einen Computer, aber wer genügend Geduld hat, kann die entsprechende Software bereits heute auf einem PDA installieren und von einem Wlan-Hotspot aus voipen (VoIP = Voice over IP, IP ist das Internetprotokoll). Auf Ende Jahr werden dann die ersten Handys (unter anderem von Motorola und Nokia) auf den Markt kommen, die sich einerseits mit dem Mobilfunknetz und andererseits mit Wlan verstehen. Die Zahl der kostenlosen Hotspots steigt ständig an, sodass vor allem in Ballungszentren das Telefonieren deutlich billiger wird – wenn man sich nur an den richtigen Orten aufhält.
Eintrittskarte ins mobile Internet
Überall ausser im Büro sein und gleichzeitig im Internet, das tönt verlockend.
Zwar konnte man sich schon früher mit Laptop und Handy auf eine Wiese setzen und per Mobiltelefon den Cyberspace kontaktieren. Bloss war diese Art der Datenübermittlung langsamer als die Schnecken, die einem durchs Blickfeld huschten, während man müden Auges auf dem Bildschirm das Eintrudeln der Mails beobachtete.
Erst die Unlimited-Karte von Swisscom Mobile machte den Internetzugang schnell und einfach. Sie ist eine Art sehr flaches UMTS-Handy, das man in den Kartenschlitz des Notebooks schiebt. Die mitgelieferte Software sorgt dafür, dass der Kontakt mit dem Internet nie abreisst.
Zwar mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, je nachdem, ob ein Wlan (bis 2 MBit/s), UMTS (max. 384 KBit/s) oder nur GPRS (50 KBit/s) erreichbar ist – aber man ist doch immer drin, ohne sich dauernd neu verbinden zu müssen.
Das schnelle UMTS gibts allerdings nur in Ballungszentren. Edge ist zwar ein bisschen langsamer (rund 200 KBit/s), dafür überall dort verfügbar, wo man Swisscom-Empfang hat. Darum gibts ab sofort eine weitere Unlimited-Karte: Statt UMTS bietet sie Edge, zudem ist sie deutlich kleiner, sodass sie beim Versorgen im Laptop verbleiben kann, ohne dass sie abbricht.
Die neue Softwareversion versteht sich nun endlich auch mit dem eigenen Wlan zu Hause oder im Büro. Und was der Hersteller zwar nicht ausdrücklich empfiehlt, aber in unserem Test mit drei verschiedenen Laptops funktioniert hat: Man kann dieselbe Software für beide Karten verwenden! Das heisst: In den Städten surft man mit dem schnelleren UMTS, überall sonst mit Edge.
Bei unseren Testfahrten vom Tessin nach Zürich bzw. von Davos nach Zürich funktionierte das tadellos und unterbrechungsfrei mit 80 bis 180 KBit/s. Selbst im Gotthardtunnel waren es immer um die 100 KBit/s.
Die Unlimited-Karten für Windows kosten je 99 Franken bei zwölf Monaten Vertragsdauer. Zur Grundgebühr für die verwendete SIM-Karte kommen noch 79 Franken pro Monat dazu (für Studenten 29 Franken). Darin ist ein Gigabyte Datenverkehr pro Monat inbegriffen. Was darüber hinaus heruntergeladen wird, kostet extra.
Unlimited-EdgeKarte, 99 Franken, http://www.swisscommobile.ch. ★★★★★
HELPLINES Über Probleme redet man lieber in einer Sprache, die einem geläufig ist und in der man sich gut ausdrücken kann. Das gilt nicht nur für zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch für solche zum PC.
VON PETER WOLF
Wenn man schon nicht genau weiss, wie man beschreiben soll, dass der PC nicht das tut, was man von ihm erwartet (und worin diese Erwartung genau besteht), dann ist es hilfreich, wenn man wenigstens so darüber reden kann, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Dessen ist sich auch Stefan Buess von der BNS Group bewusst, die von Biel aus die offizielle MicrosoftSupport Hotline betreibt und für diverse ADSL-Anbieter und Gerätehersteller den Telefonsupport übernimmt: «Viele Schweizer können sich auf Hochdeutsch weniger gut artikulieren, geschweige denn auf Englisch. Zudem gibts von vielen Programmen und Geräten lokale Versionen, das fängt schon bei den Umlauten auf der Tastatur an.» Nicht zuletzt ist der Firmensitz deswegen in Biel, weil man dort auch leichter zweisprachige Mitarbeiter findet. Viele seiner 280 Agents sind bilingue, und er kann auch mit Deutsch und Italienisch dienen. «Firmen, die Wert auf den Schweizer Markt legen, wollen auch Support in der Landessprache bieten», sagt BNS-Geschäftsführer Stefan Buess. Doch so ein Service ist nicht billig, und daher lagern viele internationale Firmen ihre gesamte Hotline in ein Billiglohnland aus. Der Ratsuchende wählt zwar eine lokale Telefonnummer, wird aber an die zentrale Hotline verbunden, wo er dann radebrechend seine Probleme mit einem Produkt schildert und sich abmüht, die Englisch gesprochenen Anweisungen zu verstehen.
Umso erstaunlicher ist, dass es auch umgekehrt geht: T-Systems betreibt aus der teuren Schweiz eine zentrale mehrsprachige Helpline für internationale Firmen. Die Anrufer merken gar nicht, dass sie mit ihrer Anfrage in Zollikofen BE landen. Sie wird in der jeweiligen Sprache des Anrufers beantwortet. Weil alle Supporter beieinander sitzen, können sie als Krankheitsvertretung einspringen, Synergien nutzen und Erfahrungen schnell austauschen.
Vielsprachige sind in der Schweiz einfacher zu finden
Kommunikationsleiter Daniel Hinz sieht für Zollikofen einen grossen Standortvorteil: «In der Schweiz, vor allem nahe der Sprachgrenze, ist es viel einfacher, mehrsprachige Mitarbeiter zu finden. Auch der hohe Bildungsstandard kommt unserem Qualitätsanspruch entgegen.»
Nikolaos Balomatis, Basler aus Thessaloniki, fand bei T-Systems seinen Traumjob: «Ich habe mir schon immer gewünscht, mit meiner Muttersprache zu arbeiten.» Er war vorher Field Supporter in einer Basler Chemiefirma, besass also PC-Erfahrung. Jetzt kann er nicht nur auf seinem PC zu Hause mit Windows auf Griechisch arbeiten, sondern auch während der Arbeit, wenn er einem Athener Agfa-Mitarbeiter telefonisch bei einem Computerproblem hilft. «Manche Ausdrücke muss ich zwar im Lexikon nachschlagen – aber wichtig ist, dass man die Ratsuchenden in ihrer Sprache bedienen kann. Händchenhalten gehört eben auch zu meinen Aufgaben.» Manchmal müssen Helpdesk-Mitarbeiter aber auch im Ausland gefunden werden: Frido Romeijn aus Antwerpen wurde nach dem Studium von einem Freund nach Zollikofen geholt. Er hilft nun den Agfa-Angestellten auf Niederländisch und Belgisch weiter.
Aktuell werden 9 Sprachen angeboten, jeder Helpdesk-Mitarbeiter beherrscht mindestens drei Sprachen, Teamsprache ist Deutsch, wenns schnell gehen muss aber auch Englisch. Fatima Sanchez aus Bern beherrscht gar sechs Sprachen: Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Englisch und Deutsch. Sie ist eine von den guten Seelen, die einem Vorwerk-Mitarbeiter mit Computerproblemen weiterhelfen. Dabei muss sie nicht nur auf die jeweilige Sprache, sondern auch auf die Mentalität umschalten: «Deutsche sind manchmal distanziert und kommen schnell auf den Punkt. Italiener sind spontan, Spanier locker und spassig, Franzosen fordern viel und sind heikel, wenn sie einen Akzent bemerken.» Aber eben: «Die Leute mögen unterschiedlich sein, ihre PC-Probleme sind überall die gleichen.»
NAVIGATION UND ROUTENPLANUNG Hilfe aus dem Cyberspace und dem Weltall.
VON PETER WOLF
Wer mit Atlas und Strassenkarte seine liebe Mühe hat, weil er früher im Geografie-Unterricht lieber aus dem Fenster schaute, darf dieser Gewohnheit treu bleiben und weiterhin Fenster anschauen – auch wenn es sich dieses Mal um solche auf Computermonitoren handelt.
Neueste Kommentare